Was hat der Steuerzahler davon, wenn er Forschung zu «Whiteness» im Werk Dürrenmatts, zum feministischen Widerstand gegen die Inklusion von Transfrauen oder zu fellbespannten Streichinstrumenten im späten Mittelalter finanziert? Das fragte sich der Journalist Rico Bandle jüngst in einem Artikel der «SonntagsZeitung» und präsentierte «Fragwürdiges» und «Skurriles» aus der Forschungsdatenbank des Schweizerischen Nationalfonds. Die Reaktion der Forschungsgemeinschaft folgte auf den Fuss: Online und offline empörte man sich über die Dreistigkeit, seriöse Forschung ins Lächerliche zu ziehen. Im Interview mit «Reatch» sagt Bandle: «Es geht letztlich um Steuergelder, mit denen solche Forschung finanziert wird. Die Menschen haben ein Recht zu erfahren, was damit geschieht, und es ist meine Aufgabe als Journalist, das zu beleuchten.»
Das stimmt – und dennoch fragt sich, ob es nicht mehr Licht braucht, damit man sich ein gutes Bild von Wissenschaft machen kann. Zeit, sich einige der Projekte genauer anzuschauen.
«Dürrenmatts Biografie ist eng verbunden mit der Dekolonialisierung»
Das Projekt «‹Whiteness› im Werk Friedrich Dürrenmatts» will wissen, wie der Schweizer Weltschriftsteller «weisse» und «nicht-weisse» Figuren in seinen Werken auftreten lässt. Die Forschung stützt sich auf die in den USA entstandenen «Critical Whiteness Studies» – und wird deswegen von Bandle kritisiert. Er moniert, es sei «Mode geworden, amerikanische Rassismus-Theorien eins zu eins in die Schweiz zu übertragen». Versuchen die Forschenden, Dürrenmatts Werk in ein ideologisches Korsett zu zwängen?
Melanie Rohner winkt ab: «Die Literaturwissenschaft arbeitet mit dem, was in einem Text angelegt ist.» Die Germanistin ist Professorin für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Bern und hat das Forschungsprojekt erarbeitet. Ziel der Literaturwissenschaft sei es nicht, eine absolut gültige Lesart zu finden, sondern neue Perspektiven auf einen Text zu eröffnen – wissenschaftlich belegt und mit grösstmöglicher Objektivität bei der Forschungsarbeit.
Im Übrigen müsse man Dürrenmatt die Auseinandersetzung mit Rassismus und Kolonialismus nicht aufdrücken, er habe sie selbst gesucht in seinem Werk, meint Rohner. In «Die Virusepidemie in Südafrika», 1994 postum veröffentlicht, lässt ein mysteriöses Virus weisse Menschen plötzlich schwarz werden. Das Apartheidsregime zerfällt, weil der Versuch, die «weissen Schwarzen» von den «schwarzen Schwarzen» zu unterscheiden, zum Scheitern verurteilt ist. Auch bei «Ein Engel kommt nach Babylon» (1953), «Abu Chanifa und Anan ben David» (1975) oder «Winterkrieg in Tibet» (1981) weisen bereits die Werktitel auf eine Auseinandersetzung mit Fremdem hin.
«Dürrenmatts Biografie ist eng verbunden mit der Dekolonialisierung: Als er 1921 geboren wurde, war ganz Afrika noch kolonialisiert, mit Ausnahme von zwei Staaten. Als er 1990 starb, hatte soeben das drittletzte afrikanische Land seine Unabhängigkeit erlangt. Dürrenmatt erlebte zu Lebzeiten mit, auch durch seine Reisen in Amerika, Afrika und der Karibik, wie sich diese Länder von der Kolonialherrschaft befreiten», hält Rohner fest. Das habe auch sein Werk geprägt und aus diesem Grund hätten Dürrenmatts Werke in vielen Ländern des globalen Südens Erfolge gefeiert – auch jene Texte, die auf den Blick nichts mit Kolonialismus zu tun hätten. Rohner nennt als Beispiel das Stück «Der Besuch der alten Dame». Die «tragische Komödie» handelt von der Milliardärin Claire Zachanassian, welche die Kleinstadt Güllen zuerst finanziell ruiniert, indem sie heimlich alle Fabriken und Grundstücke aufkauft, um dann mit ihrem Geld die Bewohner nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen. Das Stück wurde 1992 im Senegal verfilmt – mit der Weltbank in der Rolle der alten Dame.
«Whiteness» als Forschungsmethode
Doch was hat es nun mit dieser «Whiteness» auf sich? «Im Grunde geht es bei unserer Untersuchung um eine Frage, die Literatur schon immer gestellt hat», erklärt Rohner. «Welche Identität geben wir uns? Wie wird das Fremde vom Eigenen abgegrenzt – und was sagt diese Abgrenzung wiederum über uns selbst aus?» Die Whiteness-Forschung eröffne eine neue Perspektive auf Dürrenmatts Texte, so Rohner.
So, wie man in den Naturwissenschaften einen Datensatz mit verschiedenen statistischen Methoden auswerten kann, kann man also einen Text aus verschiedenen literaturwissenschaftlichen Blickwinkeln untersuchen. Dennoch stellt sich für den Laien die Frage, was sich dank der Whiteness-Forschung in Dürrenmatts Werk entdecken lässt, das nicht schon längst bekannt ist.
Sabine Barben, die als Doktorandin gemeinsam mit Melanie Rohner forscht, hält dem entgegen, dass der literaturwissenschaftliche Blick auf die Auseinandersetzung zwischen den Eigenen und dem Fremden lange einseitig war: «Das Eigene wurde als gegeben angenommen, das Fremde existierte nur in Abgrenzung zu diesem Eigenen. Die Whiteness-Forschung hat diesen Blick umgekehrt, in einen globalen Kontext gestellt und gefragt: Wer wird in einem Text als ‹weiss› dargestellt, wer als ‹nicht weiss›, und wie werden die beiden Kategorien literarisch voneinander abgegrenzt? Vermittelt der Text Hierarchien, spricht er also über das Eigene in Form einer übergeordneten Identität der Europäer und über das Fremde in Form des Untergeordneten? Kritisiert er diese Hierarchie vielleicht auch?»
Dürrenmatt eigne sich für diese Untersuchung besonders gut, weil er bewusst mit diesen Vorstellungen vom Eigenen und vom Fremden gespielt habe, wirft Rohner ein. «Dürrenmatt hatte eine extreme Fabulierlust. Er arbeitete mit Karikaturen und überspitzte vieles, was er in seiner Umwelt beobachtete. So zeigte er unter anderem, dass viele Vorstellungen, die zu seiner Zeit über schwarze Menschen kursierten, im Grunde absurd waren. Unsere Forschung will herausfinden: Mit welchen sprachlichen und erzählerischen Techniken arbeitete Dürrenmatt, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen?»
«Ohne Kunst und Kultur wäre unser aller Leben viel ärmer»
Wenn Rohner und Barben von ihrer Forschung erzählen, spürt man nicht nur die Begeisterung und den Respekt für das Werk Dürrenmatts, sondern wird auch angesteckt von ihrem Forschungsdrang. Aber reicht das? Ist die neue Auseinandersetzung mit alten Texten relevant genug, um dafür Steuergelder auszugeben? Barben hört die Frage nicht zum ersten Mal: «Es erstaunt mich immer wieder, dass man den Geisteswissenschaften mangelnde Relevanz vorwirft. Bücher, Kunst, Filme, Musik spielen im Alltag vieler Menschen doch eine zentrale Rolle und verhandeln jene Themen, die das Leben ausmachen: Beziehungen und Verlust, Hoffnungen und Ängste, Identität und Fremdheit.»
Dem würde Thomas Gartmann wohl zustimmen. Der Musikwissenschaftler ist Leiter Forschung an der Hochschule der Künste in Bern und ist überzeugt: «Ohne Kunst und Kultur wäre unser aller Leben viel ärmer.» Und er ärgert sich über die Oberflächlichkeit, mit der Bandle die verschiedenen Projekte präsentiert habe: «Als Theaterwissenschaftler hätte der Autor wissen müssen, dass man zuerst etwas anschauen soll, bevor man darüber schreibt. Eine Zusammenfassung zu lesen genügt nicht.»
«Selbst wenn ein guter Zweck dahintersteckt [...], müssen wir als Journalisten dennoch hinschauen und fragen können: Läuft alles richtig?»
Auch Gartmanns eigene Forschung hat es in Bandles Auswahl von «skurrilen» und «fragwürdigen» SNF-Projekten geschafft: In «Rabab & Rebec: Erforschung von fellbespannten Streichinstrumenten des späten Mittelalters und der frühen Renaissance und deren Rekonstruktion» hat Gartmann die Kulturgeschichte von zwei Instrumententypen untersucht, die im 14. bis 16. Jahrhundert weit verbreitet gewesen sind und heute noch in ähnlicher Form etwa in Marokko gespielt werden. Doch wozu das Ganze?
«Im Vordergrund jedes Forschungsprojekts steht zuerst das wissenschaftliche Interesse. In unserem Fall wollten wir herausfinden, wie diese beiden Instrumente – das Rabab und das Rebec – im Mittelalter gebaut und benutzt wurden und welchen kulturellen Stellenwert sie hatten.» Dazu hat Gartmann gemeinsam mit anderen Forschenden akribisch all jene historischen Quellen zusammengetragen, in denen die Instrumente zu finden waren. Ebenso haben sie die Instrumente nachgebaut, ihre akustischen und musikalischen Eigenschaften vermessen und damit sogar Konzerte aufgeführt. «Das hat Zeitungen, Radio und Fernsehen, auch international, sehr interessiert», sagt Gartmann. Doch er betont, dass das Projekt auch einen Beitrag dazu leistet, die Entstehung von Kultur und Kulturaustausch besser zu verstehen: «Rabab und Rebec sind heute vor allem im Maghreb verbreitet, aber wir finden Spuren von solchen und verwandten Instrumenten von Indien über Afghanistan und dem Iran bis hier zu uns in der Schweiz. Im Kreuzgang des Zürcher Grossmünsters ist beispielsweise auf einer Säule ein Instrument ausgemeisselt, das verwandt ist mit Rabab und Rebec.»
Die Pandemie als Augenöffner: Kunst und Kultur sind wichtig für das Wohlbefinden
So gesehen kann man Gartmanns Forschung auch als einen Beitrag dazu sehen, abstrakte Dinge wie «Kulturtransfer» fassbar zu machen. Gerade in Zeiten erhitzter Debatten über «kulturelle Aneignung» und «Leitkultur» kann der nüchterne Blick der Forschung dabei helfen, die Relationen zu wahren und die verschiedenen Formen von kulturellem Austausch zu verstehen.
So lässt sich am Beispiel des Rabab und des Rebec konkret nachzeichnen, auf welchen Wegen ein solcher Austausch erfolgen kann. Aber auch Kulturformen, die als typisch schweizerisch gelten, eignen sich als Anschauungsbeispiele: «Instrumente wie das Alphorn finden sich auch im hohen Norden oder im Fernen Osten. Und das Jodeln ist aus dem Tirol in die Schweiz gelangt», erklärt Gartmann.
Man merkt ihm an, dass er nicht zum ersten Mal erklären muss, warum es sich lohnt, Kunst und Kultur zu erforschen. «Die Pandemie war in dieser Hinsicht ein Augenöffner. Während die Medizin und Naturwissenschaften ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt sind, hat man uns deutlich gesagt: Ihr seid nicht systemrelevant. Das gab natürlich schon zu denken.»
Später hätten glücklicherweise viele gemerkt, dass Kunst und Kultur eine nicht unwichtige Rolle spielen würden für das Wohlbefinden der Bevölkerung. Man habe auf wissenschaftlicher Seite aber auch gelernt, sich besser zu verkaufen. Dabei hätte es ein angewandtes Projekt – zum Beispiel im Bereich des Gesundheitsdesigns oder der Signaletik – natürlich einfacher als eher künstlerisch ausgerichtete Forschung. Entscheidend sei aber in allen Fällen, dass man sich überlege, was die Essenz eines Projekts sei. Ausgehend davon könne man dann Übersetzungsarbeit leisten und versuchen, den gesellschaftlichen Wert des Projekts verständlich zu machen. Trotzdem mahnt Gartmann: «Man sollte nicht meinen, mit jedem Projekt könne man die Welt verbessern. Das ist auch gar nicht die Aufgabe der Wissenschaft.»
Wissenschaft: Nützlich sein, ohne nützlich sein zu wollen
Aktuell scheint Forschung – auch in den Naturwissenschaften – in einer kommunikativen Zwickmühle gefangen zu sein: Ist sie zu weit weg von der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder politischen Praxis, dann wirft man ihr mangelnde Relevanz vor. Doch wenn sie plötzlich relevant wird, wenn sie sich mit aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen beschäftigt, ist sie schnell dem dem Generalverdacht ausgesetzt, aktivistisch und nicht mehr wissenschaftlich zu sein.
Rico Bandle sagt, dass es eine Rechtfertigung dafür braucht, Steuergelder für die Forschung einzusetzen, und dass Forschende deshalb nicht umhin kommen, sich Debatten über den Wert ihrer Forschung zu stellen. Das stimmt zwar, doch dieser Anspruch lässt sich nur dann erfüllen, wenn es einen medialen Rahmen gibt, in dem solche Debatte stattfinden können kann. Die Soziologin Madeleine Pape – auch ihr Projekt findet sich in Bandles Artikel – kritisiert zurecht die politische und mediale Tendenz, öffentliche Debatten in ein Korsett zu zwingen, das keinen Raum mehr lässt für Zwischentöne.
«Ich denke, wir müssen Räume schaffen, in denen ein bedeutungsvoller Dialog stattfinden kann.»
Doch Wissenschaft lebt davon, eben diese Zwischentöne zu treffen, neue Perspektiven zu eröffnen und bestehende Gewissheiten zu hinterfragen. Medienschaffende, die es nicht schaffen, dem Raum zu geben, fördern damit das, was sie mitunter kritisieren: Forschende, die sich nicht scheuen, im Namen der Wissenschaft politisch Position zu beziehen.
Auch der von den Medien bisweilen geschürte Anspruch, Forschung müsse um jeden Preis praktisch relevant sein, unterläuft das, was Wissenschaft auszeichnet: Den Dingen so auf den Grund gehen zu können, wie es im Alltagsstress unmöglich ist. Das Versprechen von Wissenschaft ist nicht, dass sie jedes praktische Problem im Handumdrehen lösen kann. Ihr Versprechen ist nicht einmal, dass sie sich um praktische Probleme kümmern muss. Wissenschaft verspricht bloss, Wissen zu schaffen. Dieses Wissen sollte allen, die sich dafür interessieren, offen stehen und es darf selbstverständlich auch dazu verwendet werden, in Gesellschaft, Wirtschaft oder Politik Nützliches zu tun. Doch wer die unmittelbare Nützlichkeit zum Massstab dafür macht, ob sich ein einzelnes Projekt lohnt oder nicht, der hat weder Wissenschaft noch ihren Wert für die Gesellschaft verstanden
Die Beiträge auf dem Reatch-Blog geben die persönliche Meinung der Autor*innen wieder und entsprechen nicht zwingend derjenigen von Reatch oder seiner Mitglieder.
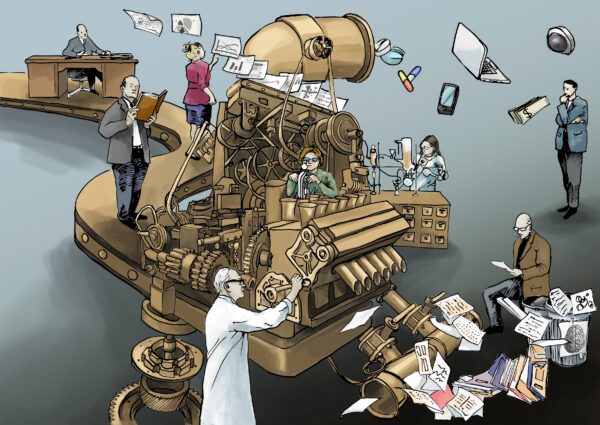
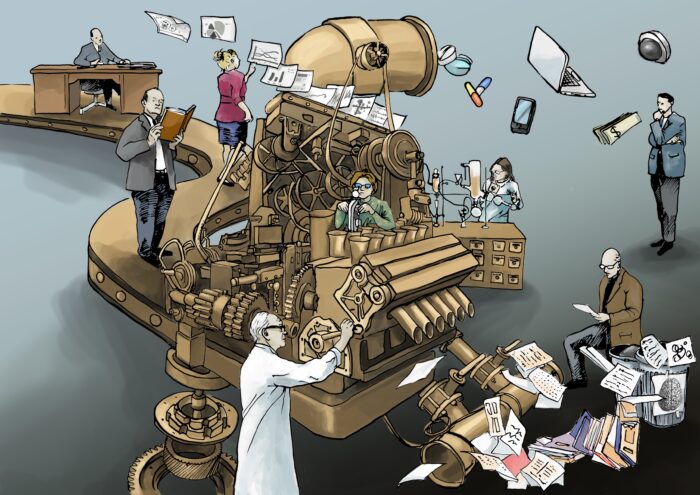

Comments (0)