Die Corona-Pandemie oder die Klimakrise zeigen eindrücklich, dass viele Herausforderungen unserer Gegenwart multidisziplinäre Lösungen bedingen: Rein medizinische Ansätze wie Impfungen alleine reichen beispielsweise nicht aus, um die Pandemie zu bekämpfen. Auch die Verteilung der Impfdosen muss gerecht organisiert werden. Diese Beispiele machen deutlich, dass multidisziplinäre Ansätze gefragt sind.
Christina Warinner ist Professorin für Anthropologie und Expertin für multidisziplinäre Forschung. Das muss sie sein, denn als mikrobielle Archäologin braucht sie chemische, biologische, anthropologische, historische und archäologische Kenntnisse, um erfolgreich forschen zu können. Die mikrobielle Archäologie untersucht biologische Evidenz von archäologischen Fundstätten, so zum Beispiel alte DNA. Im Interview gibt Warinner Einblick in ihre Arbeit an der Universität Harvard und am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena und beleuchtet die Chancen und Herausforderungen multidisziplinärer Forschung.
Angela Odermatt: Die meisten Menschen denken bei Archäologie wahrscheinlich an Pharaonen, Ötzi oder Indiana Jones. Welche Rolle spielt dabei alte DNA?
Christina Warinner: Indiana Jones, zum Beispiel, ist in gewisser Weise im Kolonialismus angesiedelt. Das Ziel ist, ein Objekt zu ergattern und in ein Museum zu stellen. Eigentlich ist das Interessante an der Archäologie aber nicht ein bestimmtes Objekt, sondern Geschichten aus der Vergangenheit zu erzählen. Um das zu tun, muss man sich die ganze Fundstätte, also das ganze Bild, ansehen. Für mich ist es oft das von Auge Unsichtbare, das uns am meisten über die Vergangenheit erzählt. Es handelt sich dabei um Moleküle und DNA oder die Arten von Lebensmitteln, die die Menschen gegessen haben. Das gibt uns Aufschluss über Handelsrouten, Fernhandel und Kultur.
Wie bist Du zur mikrobiellen Archäologie gekommen?
Hauptsächlich durch Zufall. Am Anfang stand ein starkes Interesse für Mikrobiologie. Später, als ich meinen Bachelor-Abschluss machte, begann ich Kurse in Archäologie zu belegen und war fasziniert von den Fragen, die man der Vergangenheit stellen kann. So kam ich zur Archäologie. Insbesondere wollte ich mit meiner naturwissenschaftlichen Ausbildung an die Archäologie herangehen. Damit wollte ich Neues über die Vergangenheit herausfinden, das man mit herkömmlichen archäologischen Techniken nicht erkennen konnte.
Angefangen habe ich mit antiken Diäten und bin dadurch zu ernährungsbedingten Krankheiten gekommen. Dies hat mich zum Mikrobiom und zu Mikroben geführt. Mikroben sind äusserst interessant, da sie nicht nur für Krankheit, sondern auch für die Gesundheit wichtig sind.
Das hört sich so an, als gäbe es viele verschiedene Themen, die in diesem Bereich kombiniert werden. Was muss man also wissen und können, um mit alter DNA zu arbeiten?
Die ersten Pioniere auf dem Gebiet der alten DNA kamen aus ganz unterschiedlichen Bereichen: Molekularbiologie, Zoologie, Archäologie und Chemie. Bei meiner Forschung am Mikrobiom kommen dann noch mehr Leute aus der Mikrobiologie, Ökologie oder Informatik dazu.
Ich mag es sehr, an der Schnittstelle zwischen den verschiedenen Disziplinen zu arbeiten und finde, dass dort die aufregendste Wissenschaft betrieben wird. Manchmal wird innerhalb eines Fachgebiets Wissen vorausgesetzt und nie explizit gesagt. Ich habe das Gefühl, dass das Innovation und Kreativität ersticken kann. Wenn man ständig mit Leuten aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeitet, ist man gezwungen zu erklären, was man meint. Das führt zu diesen grossartigen Momenten, in denen wir Verbindungen herstellen oder etwas erkennen, an das wir vorher nie gedacht hätten. Ich arbeite wirklich gerne in multidisziplinären Teams, weil sie einen dazu herausfordern, über den Tellerrand zu schauen. Ich glaube, dass Innovation genau von dort kommt.
Hast Du ein konkretes Beispiel dafür, wie Multidisziplinarität in Deiner Forschung aussieht?
In all meinen Projekten kommen immer Leute zusammen, die normalerweise nichts miteinander zu tun hätten. Beispielsweise begannen wir 2011 mit einer Studie über Parodontalerkrankungen. Wir wollten herausfinden, ob sich die Ursachen im Laufe der Zeit verändert hatten oder ähnlich waren. Ich arbeitete dafür mit einer Skelettsammlung aus einer Fundstätte namens Dalheim in Deutschland. Mit molekularen Techniken versuchten wir, die in den Skeletten vorhandenen Bakterientypen zu identifizieren.
Am Ende des Projekts hatten wir Teammitglieder, die Sozial-, Geistes- und Naturwissenschaften, alles von der Physik bis zur mittelalterlichen Geschichte, abdeckten. All diese Leute arbeiteten zusammen, um diesen einen Friedhof in Deutschland zu verstehen. Wir lernten so viel über das Leben, den Handel, die Gesundheit und Krankheiten. Es war eine wirklich unglaubliche Erfahrung.
Meine Rolle war es, der Klebstoff zu sein, der uns alle zusammenhielt. Gewissermassen war ich eine Art Übersetzerin zwischen den Disziplinen. Da habe ich gemerkt, dass ich diese Rolle, die Wissenschaft und Kommunikation über Disziplinen hinweg, wirklich liebe.
Und wie hast Du diese Kommunikation über verschiedene Disziplinen hinweg erreicht? Gibt es etwas, das gut funktioniert und was sind die Herausforderungen?
Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge bei der Zusammenarbeit ist, Sachverhalte wirklich zu erklären und Wissen nicht einfach vorauszusetzen. Leute haben oft Angst, dass andere sie nicht für klug genug halten oder nicht von ihnen beeindruckt sind. Deshalb neigen sie dazu, eine sehr komplizierte Sprache oder Fachjargon zu verwenden. Das führt aber nur zu Missverständnissen und Unklarheiten. Ich habe festgestellt, dass es wirklich am besten ist, in einer möglichst einfachen und verständlichen Sprache zu sprechen. Ich muss auch in der Lage sein, die Erklärungen während des Gesprächs an die anderen anzupassen und viele Fragen zu stellen. So kann man Vertrauen aufbauen und sinnvolle Gespräche führen. Man kann so viel auf beiden Seiten lernen und das macht mir Spass.
Apropos Kommunikation: Du hast bereits TED Talks gehalten und arbeitest an einem Malbuch über mikrobielle Archäologie. Wie wichtig ist die Öffentlichkeitsarbeit für Dich?
Öffentlichkeitsarbeit ist sehr wichtig für mich. Ich denke, dass sich die gesamte Forschung zumindest bis zu einem gewissen Grad daran beteiligen sollte. Als Forscher*innen haben wir das Glück, öffentliche Mittel für unsere Arbeit zu erhalten. Wir können nicht von der Öffentlichkeit erwarten, das sie uns weiterhin finanziert, wenn wir nicht sagen, was wir tun. Wir sollten erklären oder zeigen, wie Forschung mit ihrem Leben zusammenhängt und warum sie wichtig ist.
Ich denke aber auch, dass unsere Forschung einfach so aufregend und wichtig ist. Die Vergangenheit ist für die heutige Zeit relevant. Es gibt so viele Dinge, von denen wir glauben, dass wir sie zum ersten Mal erleben. Es ist aber nicht das erste Mal. Es ist nicht das zehnte Mal. Es ist nicht das hundertste Mal. Die Vergangenheit ist einer unserer besten Lehrmeister und wir können aus ihr lernen.
Zum Abschluss: Welche Hoffnung hast Du für eine multidisziplinäre Zukunft?
Ich bin wirklich begeistert von der mikrobiellen Archäologie. Lange Zeit waren die Werkzeuge zur Analyse der alten DNA nicht stark genug. Das hat sich jetzt geändert. Unsere Techniken sind mittlerweile so leistungsfähig und die Dinge, die wir lernen, so wichtig, dass sie nicht nur unser Fachgebiet betreffen, sondern sogar Teile der Biologie neu schreiben.
Unser Verständnis wie sich Krankheiten entwickelt haben, ändert sich aufgrund der Erkenntnisse, die wir aus der alten DNA gewinnen. Das Gleiche gilt für Modelle, die zeigen wie Populationen interagieren und sich verändern. Unser Gebiet ist an einem Punkt angelangt, an dem wir nicht mehr nur ein winziger Zweig von etwas sind, sondern wirklich zum Hauptbereich der Wissenschaft gehören.
Eine der Herausforderungen bei unserer Arbeit besteht darin, dass wir nicht nur Fachbereiche, sondern auch Disziplinen und Gruppen von Disziplinen miteinander verbinden. Die meisten Universitätssysteme stecken einen schon früh in eine dieser Disziplinen und man lernt nichts über die anderen. Heute erkennen wir, dass dies nicht mehr so hilfreich ist und wir mehr multidisziplinäre Ausbildung brauchen. Um die Geschichten der Menschheit zu erzählen, muss man Teile der Naturwissenschaften, der Statistik und der Mathematik kennen. Gleichzeitig muss man Aspekte der Anthropologie, Soziologie und Geschichte verstehen, weil man sonst sehr vereinfachende Annahmen trifft. Ich finde es daher wichtig, darüber nachzudenken, wie die Zukunft der universitären Bildung aussehen wird und wie wir den Menschen fundiertes und gleichzeitig multidisziplinäres Wissen vermitteln können.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen der Sommerakademie «Von Antibiotika aus der Steinzeit zu Krankheitserregern in der Neuzeit» der Schweizerischen Studienstiftung und wurde redaktionell begleitet von Reatch. Den Originalbeitrag gibt es hier.
Die Beiträge auf dem Reatch-Blog geben die persönliche Meinung der Autor*innen wieder und entsprechen nicht zwingend derjenigen von Reatch oder seiner Mitglieder.
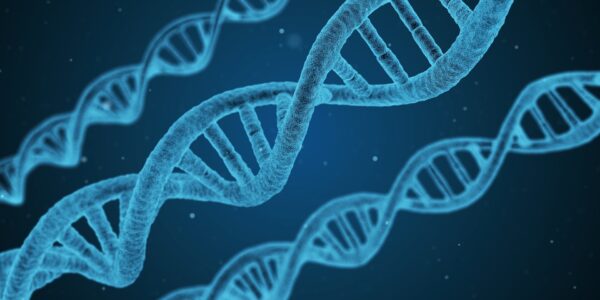
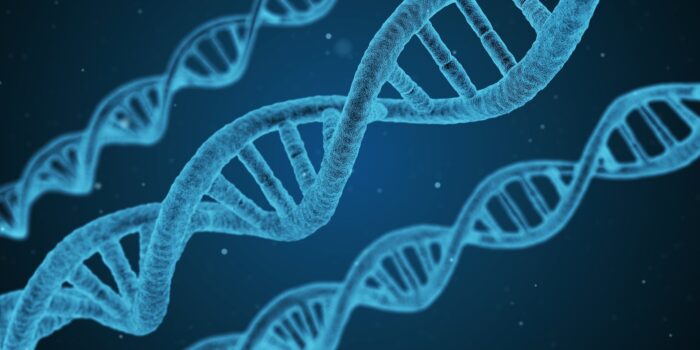

Comments (0)