In Wuhan, China breitet sich ein Virus aus, das bis in die Schweiz hohe Wellen schlägt. Die Nachrichten über das Coronavirus verunsichern und die Zahl bestätigter Toten scheint besorgniserregend hoch. Die Kommunikation zum Coronavirus weist aber einige Unterschiede zur Kommunikation über vergangene Epidemien wie der Vogelgrippe auf, meint Sabrina Heike Kessler vom Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Uni Zürich: «Es wird zum einen von Regierungen und Gesundheitsorganisationen gezielt versucht, gegen Fake News zum Coronavirus vorzugehen. Des Weiteren versuchten Wissenschaftler*innen und Medizinjournale eng zusammenzuarbeiten, um eine Pandemieforschung in Echtzeit und sofortige Transparenz als Gegenmittel für Desinformation bereit zu stellen.» Leider sind diese Bemühungen bisher nicht so erfolgreich wie erhofft. Auf den sozialen Medien häufen sich Fake News zum Coronavirus und Internet-Kommentatoren, Boulevard-Medien oder der Sitznachbar am Stammtisch entwerfen mit Genuss Horrorszenarien, die glatt als Drehbuch für den neuesten Hollywood-Streifen durchgehen könnten.
Expert*Innen hingegen verfügen über das nötige Wissen, um die News aus Asien einordnen zu können und bleiben trotz Besorgnis von der Panikmache verschont. Sie wissen, welche Verhaltensweisen angebracht sind. Genau dieses Wissen sollte auch in der breiten Öffentlichkeit schneller ankommen. Das jüngste Beispiel Coronavirus macht es einmal mehr deutlich: wir brauchen gute Wissenschaftskommunikation.
Diese Kommunikation ist vielseitig. Eine Podiumsdiskussion mit einer Neurobiologin, eine Medienmitteilung der ETH über die frischesten Forschungsdurchbrüche oder ein Zeitungsbericht mit neuen Gedankenanstössen aus der Philosophie. Egal, welches Format die Wissenschaftskommunikation annimmt; wichtig ist, dass es sie gibt. Denn nicht nur im Gesundheitsbereich sind wissenschaftliche Erkenntnisse oft unerlässlich für unsere Entscheidungsfindung.
Das zeigt sich vor allem in der Politik. Ein kurzer Blick auf vergangene Abstimmungen (z.B. zum Energiegesetz 2016) reicht aus, um zu erkennen, wie breit unser Wissen sein sollte, um demokratisch vertretbare Entscheidungen zu treffen. Natürlich entscheiden wissenschaftliche Fakten allein nicht über das Ja oder Nein auf dem Stimmzettel. Sie sind aber oft die Grundlage für jegliche weiterführenden Diskussionen. So gibt es verschiedene Wege, wie man mit dem Klimawandel umgehen möchte - über dessen Existenz lässt sich aber nicht mehr streiten.
Streiten lässt sich aber über die Form, die Wissenschaftskommunikation annehmen soll. Vor allem jetzt, wo wissenschaftliche Themen immer mehr öffentlich diskutiert werden. Das war nicht immer so. Im 18. und 19. Jahrhundert fand Wissenschaftskommunikation überwiegend an einem Ort statt: an den Universitäten. Priorität hatte der innerwissenschaftliche Austausch; weit weg vom «einfachen Volk» tauschten sich Forschende mit ihren Kolleg*innen aus. Selbst die Massenmedien des 20. Jahrhunderts änderten daran nicht viel. Wissenschaftliche Themen interessierten scheinbar wenig, Wissenschaftsjournalist*innen gab es praktisch keine und Wissenschaftler*innen, die sich mit ihrer Forschung an die Öffentlichkeit wagten, waren rar. [1]
Erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts begann die Phase der «Popularisierung der Wissenschaft». Ausgelöst durch den Sputnik-Schock in den USA, die Entwicklung der Atomkraft in Europa und einen Bericht der Royal Society in Grossbritannien, der schonungslos offenlegte, wie unwichtig Wissenschaft für die britische Bevölkerung offensichtlich war. Den schlechten Ruf der Wissenschaft schrieb man fehlendem Wissen auf Seiten der Öffentlichkeit zu. Als Lösung sollten mithilfe der Massenmedien Wissenschaftsinformationen breit gestreut werden. Ganz nach der Formel: mehr Informationen = mehr Wissen = mehr Akzeptanz. Heute wissen wir, dass es nicht ganz so einfach ist. Und schon damals fand das sogenannte Defizit-Modell nicht überall Zustimmung. Vielmehr gibt es nebst der einseitigen Vermittlung von den Expert*Innen zum Laien immer mehr Bestrebungen für einen Dialog auf Augenhöhe. Auch in der Forschung zur Wissenschaftskommunikation hat man diese Entwicklung festgestellt. «Heute steht oftmals ein Public Engagement with Science im Vordergrund, das darauf abzielt, Wissenschaft für Bürger*Innen interessant und greifbar zu machen, damit sie selbst zum wissenschaftlichen Diskurs beitragen können», meint Sabrina Heike Kessler. Veranstaltungen wie das FameLab, Wissenschaftscafés, unsere Reatch-eigenen Formate Reatching into the Rabbit Hole, nanoTalks, Pizza, Philosophy and Science oder gar ein Rendez-vous mit der Wissenschaft sind das Resultat davon. [2]
In den Massenmedien gerät die Wissenschaftskommunikation hingegen zunehmend unter Druck. Der eisige Wind, der seit längerem in der Medienbranche weht, macht auch vor dem Wissenschaftsjournalismus nicht halt. Aufgrund tiefer Abonnementzahlen und sinkender Werbeeinnahmen drohen Kürzungen und Ressortschliessungen. «Qualitativer Wissenschaftsjournalismus kostet Zeit und Geld. Er wird von Verlagen oftmals nur noch als ein Nice-to-have angesehen», bedauert auch Kessler. In die Bresche springt die Wissenschafts-PR, also professionelle Aussenkommunikation wissenschaftlicher Institutionen, die die traditionellen Journalist*innen immer mehr abzulösen scheint. Das Problem dabei: Wissenschafts-PR ist in den seltensten Fällen neutral. Kessler: «Der Wissenschaftsjournalismus hat eine wichtige demokratische Funktion, indem er interessenunabhängig informiert, einordnet, kritisiert und kontrolliert». Genau diese Funktion fehlt oftmals bei Wissenschafts-PR.
Ausserdem kann sich auch die Wissenschaftskommunikation nicht vor der Digitalisierung verstecken. Das Internet und soziale Medien werden immer häufiger als Quellen genutzt, um sich über Wissenschaft zu informieren. Online steht uns plötzlich die ganze Fülle an wissenschaftlichen Informationen zur Verfügung. Und das nicht nur in Form von seitenlangen Studien, sondern als YouTube-Filmchen kurz und knapp zusammengeschnitten und mit schmissiger Musik unterlegt. In kurzer Zeit können Wissenschafts-News in ansprechender Form konsumiert werden. Ausserdem melden sich Forschende über soziale Medien endlich selbst zu Wort. Ihre Forschungsarbeit kriegt damit ein Gesicht und es zeigt sich: Wissenschaft wird von Menschen gemacht.
Diese Entwicklungen bergen, ganz abgesehen von unbestreitbaren Vorteilen, auch Herausforderungen. Welche News aus dieser Informationsflut sind relevant? Welcher Quelle kann man trauen? Was wird zugunsten der Kürze alles weggelassen?
Die aufgeworfenen Fragen zeigen, woran es trotz vermehrter Kommunikation oft fehlt: Orientierung. Wer sonst nicht viel mit Wissenschaft am Hut hat, ist auf Hilfe angewiesen, wenn er sich zurechtfinden soll. Als erstes müssen die wirklich wichtigen Themen ausgewählt werden. Dann komplexe Sachverhalte verständlich dargestellt, Unsicherheiten offengelegt und umstrittene Punkte angesprochen werden. Vermittelt werden soll fundiertes Wissen aus verlässlichen Quellen. Und am besten soll dies alles einen gewissen Unterhaltungswert haben, damit es nicht in der Masse untergeht.
Eine scheinbar unlösbare Aufgabe. Neuartige Formate aus dem Wissenschaftsjournalismus bemühen sich aber, sie zu lösen und die Lücke, die verschwundene Wissenschaftsressorts hinterlassen haben, zu füllen. Ein Beispiel ist das Online-Magazin higgs. Katrin Schregenberger, Leitende Redaktorin bei higgs, meint: «Erst durch Wissenschaftsjournalismus wird Wissenschaft transparent, glaubwürdig und verständlich.» Die Verständlichkeit hängt dabei ihrer Meinung nach vor allem von der Sprache ab: «Verständliche Sprache ist das wichtigste Instrument. Wir erzählen alltagsnah und in einer Sprache, die nicht abschreckt, sondern nahe an der gesprochenen Sprache liegt.» Ausserdem kommen auf der Webseite Wissenschaftler*innen direkt zu Wort – in den Kommentarspalten, als Autor*innen von Artikeln oder in persönlichen Live-Talks. Ein kleiner Science-Check ordnet zudem präsentierte Studien kritisch ein. Denn für higgs ist es wichtig, «dass unabhängige Journalisten die Informationen kritisch betrachten» und ihrer Rolle als vierte Gewalt gerecht werden.
Die Angebote für gute Wissenschaftskommunikation in jeglicher Form sind also da.
Quellen
Schäfer, M. S., Kristiansen, S., & Bonfadelli, H. (Hrsg., 2015): Wissenschaftskommunikation im Wandel. Köln: Herbert von Halem.
Schäfer, M. S., Kristiansen, S., & Bonfadelli, H. (Hrsg., 2015): Wissenschaftskommunikation im Wandel. Köln: Herbert von Halem.
Podcast

Die Beiträge auf dem Reatch-Blog geben die persönliche Meinung der Autor*innen wieder und entsprechen nicht zwingend derjenigen von Reatch oder seiner Mitglieder.

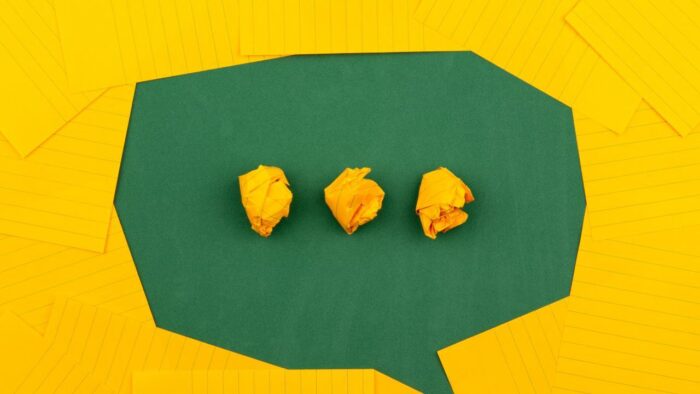
Comments (0)