Dieser Text ist am 06.04.2024 in gekürzter Version als Gastkommentar in der NZZ erschienen.
In einem jüngst erschienenen Kommentar betonen Hanna Hilbrandt, Carolin Schurr und Claske Dijkema die Verantwortung von Wissenschaftler:innen, ihr Wissen in politische Debatten einzubringen. Angesichts der Komplexität vieler gesellschaftlicher Herausforderungen ist die Wissenschaft in der Tat eine willkommene, jedoch nicht die einzige Orientierungshilfe. Ebenso relevant sind Perspektiven aus Politik, Zivilgesellschaft oder Wirtschaft, was für eine Berücksichtigung dieser Perspektiven beim wissenschaftlichen Arbeiten, aber auch bei der praktischen Umsetzung spricht.
Kaum jemand stellt solche Kollaborationen zwischen Wissenschaft und Praxis in den Natur- und Ingenieurwissenschaften infrage, sodass der Verdacht nahe liegt, dass das Trommelfeuer der Kritik, das seit einigen Monaten auf die Geistes- und Sozialwissenschaften einprasselt, auch daher rührt, dass mit ungleichen Ellen gemessen wird. Dennoch ist es falsch, die Kritik an vermeintlichem oder tatsächlichem Aktivismus von Wissenschaftler:innen bloss als politisch motiviert darzustellen.
Die Notwendigkeit von Praxiskollaborationen, um gesellschaftspolitische Herausforderungen zu meistern, ist kein Freipass dafür, die Unterscheidung zwischen wissenschaftlicher und politischer Tätigkeit aufzugeben. Im Gegenteil: Gerade weil wissenschaftliche und politische Fragen bei solchen Kollaborationen noch stärker als üblich miteinander verwoben sind, braucht es Klarheit darüber, in welcher Hinsicht die Zusammenarbeit wissenschaftlich und in welcher Hinsicht sie politisch getrieben ist. Wer die Unterscheidbarkeit zwischen Wissenschaft und Politik aufgibt, gibt auch die Sonderrolle auf, welche die Wissenschaft im politischen Prozess einnimmt und welche sie bis zu einem gewissen Grad gegen politische Kritik immunisiert.
Wer sich in der Praxis auf den wissenschaftlichen Konsens beruft oder wissenschaftliche Methoden einsetzt, verknüpft damit den Anspruch, mehr in der Hand zu haben als Spekulation, Meinung oder politische Agitation. Inwiefern dieser Anspruch erfüllt wird, kann und sollte im Einzelfall überprüft werden – nicht nur bei den Geistes- und Sozialwissenschaften, sondern auch in den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Ein mögliches Kriterium dafür sind die unterschiedlichen Ziele, die wissenschaftliche und politische Tätigkeiten verfolgen.
Wissenschaft und Politik verfolgen unterschiedliche Ziele
Das Ziel von Wissenschaft ist, Wissen zu schaffen, mit der die Welt verstanden und erklärt werden kann. Das macht sie anmassend und bescheiden zugleich. Anmassend, weil der Anspruch auf Wissen oft mit einem Anspruch auf Objektivität einhergeht, der praktisch selten eingelöst wird. Bescheiden, weil Wissen allein die Welt nicht verändert. Es braucht dazu zusätzlich einen Willen zur Gestaltung der Welt. Einen Willen, der mit politischen und nicht mit wissenschaftlichen Mitteln geschaffen wird.
Weil eine solche Gestaltung der Welt Wissen erfordert, kann sich Wissenschaft dem Politischen nicht entziehen. Wissen lässt sich damit, wie auch Hilbrandt, Schurr und Dijkema betonen, nicht losgelöst vom jeweiligen gesellschaftspolitischen Kontext produzieren. Es wäre jedoch falsch, daraus eine Verpflichtung der Wissenschaft zum politischen Handeln abzuleiten. Denn das Ziel wissenschaftlicher Tätigkeit bleibt auch dann das Schaffen von Wissen, wenn diese Tätigkeit in einem politischen Kontext geschieht.
Dass es auch innerhalb wissenschaftlicher Institutionen politische Fragen zu klären gibt und dass auch politische Institutionen Wissen schaffen können – geschenkt. Das zeigt bloss, dass die beiden Tätigkeiten auch dann voneinander unterschieden werden können, wenn sie institutionell miteinander verwoben sind. Viele der aktuellen Debatten entzünden sich jedoch just daran, dass die Möglichkeit dieser Unterscheidung verneint wird, und zwar sowohl von jenen, die Kritik an der politischen Tätigkeit von Wissenschaftlern üben, als auch von jenen, die sie verteidigen. Die einen sprechen Wissenschaftlern die Fähigkeit ab, zwischen wissenschaftlicher Arbeit und politischem Handeln zu unterscheiden, die anderen lehnen die Notwendigkeit ab, dies zu tun.
Ein Ausweg besteht darin, die Tätigkeit und die Tätigen gesondert zu betrachten. Jemand, der Wissenschaft betreibt, kann sich daneben auch politisch betätigen, ohne dass daraus zwingend eine Verletzung seiner wissenschaftlichen Pflichten folgt. Ebenso hat eine Universität nicht nur den Auftrag, wissenschaftliches Arbeiten zu ermöglichen, sondern auch die Verantwortung, einen Raum für die offene Diskussion über gesellschaftspolitische Fragen zu bieten.
Ein Problem entsteht erst dann, wenn versucht wird, wissenschaftliche Antworten auf politische Fragen zu geben. Wer das tut, bürdet die Aufgaben der Politik der Wissenschaft auf. Doch Wissenschaft, die Politik macht, unterwirft sich den Regeln der Politik. Sie hört auf, Wissenschaft zu sein. Im Verhältnis zur Politik kann Wissenschaft also nur sich selbst aufgeben oder aufgeben, selbst Politik zu machen.
Der Grat ist ein schmaler: Wird Wissenschaft aktiv in gesellschaftliche Debatten eingebracht und zur Verfolgung politischer Ziele instrumentalisiert, zieht sie den Vorwurf des politischen Aktivismus auf sich. Das untergräbt ihre Glaubwürdigkeit. Schottet sie sich im Elfenbeinturm ab von gesellschaftlichen Debatten, ignoriert sie ihre politische Dimension und überlässt die Instrumentalisierung ihres Wissens kritiklos den anderen Akteuren in der politischen Arena.
Die Beiträge auf dem Reatch-Blog geben die persönliche Meinung der Autor*innen wieder und entsprechen nicht zwingend derjenigen von Reatch oder seiner Mitglieder.
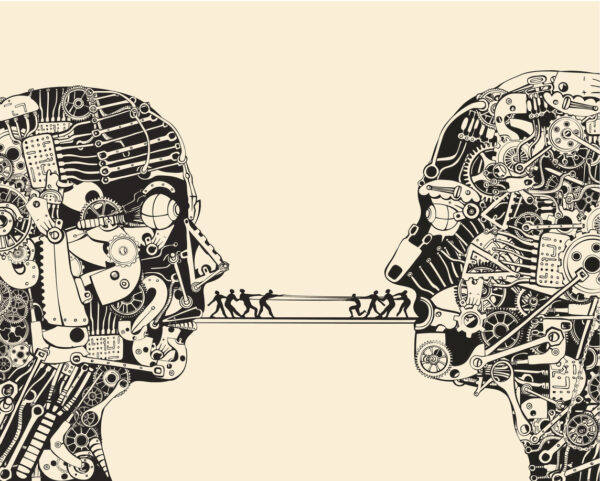
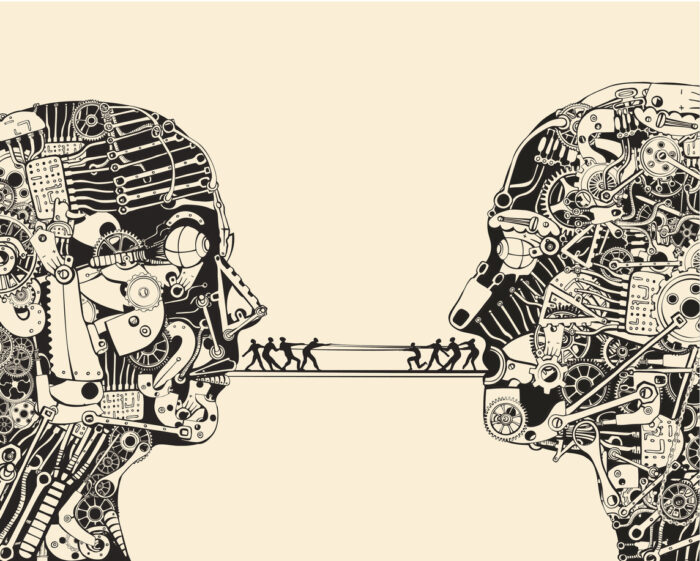



Comments (0)